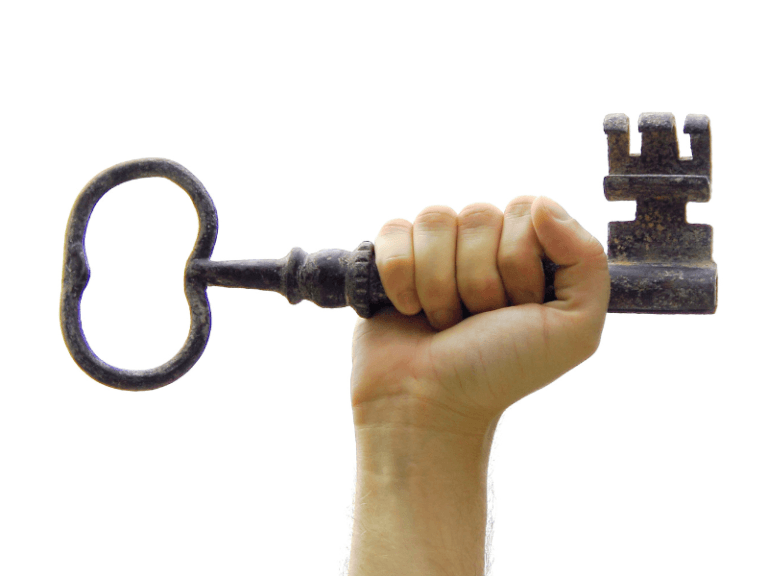Mehr Kreativität am Arbeitsplatz durch:
Wie ist man denn jetzt kreativ?
Ich habe schon beschrieben, dass Kreativität eine Fähigkeit ist, die man lernt und durchs Anwenden verbessern kann. Gleichzeitig hängt der Erfolg auch vom kreativen Akteur und seiner Persönlichkeit ab. Wenn wir an das Schaffen von etwas Neuem denken, dann landen wir zusätzlich automatisch bei einem zeitlichen Ablauf von verschiedenen Schritten von Beginn der kreativen Aufgabe bis zum Schluss, dessen Erfolg dann bewertet werden kann. Kreativität ist also auch ein Akt oder ein Prozess.
Wie funktioniert das denn genau? Wirft man oben die Problemstellung rein, wie in einer Maschine und durch verschiedene Bearbeitungstechniken kommt dann am Ende die Lösung raus? Also lineare Ideenproduktion. Es ist möglich, dass es genau so läuft. Allerdings wäre das aus meiner Sicht ein Glücksfall. Häufiger ist die Iteration und das Springen zwischen einzelnen Stufen des Prozesses.
Der kreative Akt
Am Anfang steht das Problem. Dieses muss richtig identifiziert und beschrieben werden. Sonst startet man ohne die notwendigen wichtigen Informationen in den Prozess. Wenn ich nicht weiß, was ich genau lösen möchte, dann ist es schwierig den notwendigen Weg zum richtigen Ziel einzuschlagen. Wenn ich das Problem untersucht habe, dann sammle ich weitere Informationen, die mir zur Lösung hilfreich sein können. Dann beginnt die Phase der Ideen-Generierung, dass was wir meistens als den kreativen Teil bezeichnen würden. Im Anschluss müssen die Ideen bewertet werden und es wird eine Auswahl getroffen, mit der weitergearbeitet wird. Es ist wichtig zu verstehen, dass alle Phasen zum kreativen Prozess dazugehören, denn nicht nur viele Ideen sind wichtig, sondern auch die Vorarbeit und das Auswählen.
So weit so gut. Das klingt nach einem klassischen Fall für Projektmanagement und einer schlanken Abfolge von To dos. In der Realität laufen die Phasen überlappend, wiederholend, iterativ und entgegengesetzt ab. Das haben diverse wissenschaftliche Experimente bestätigt. Diese Schleifen werden zusätzlich beeinflusst von der Situationscharakteristik und den Ressourcen des Akteurs. Der kreative Akt ist unbedingt ein Austausch mit der Umwelt und wird durch sie beeinflusst. Das heißt, ein kreativer Mensch kann nicht nur für sich kreativ sein, sondern tritt immer bewusst oder unbewusst in Kontakt mit der Welt um ihn herum.
Schwierigkeiten des kreativen Aktes
Der Prozess des kreativen Handelns beinhaltet Beobachtung, Versuch und Irrtum und wiederholte Phasen divergenten und konvergenten Denkens. Diese Dynamik und Wiederholungen bedürfen ein breites Spektrum kreativer Ressourcen. Ein kreativer Akteur braucht Offenheit, Risikobereitschaft, Phantasie und Ausdauer. Das führt dazu, dass häufig die Motivation sinkt und die schlechte Laune steigt. Es gibt Studien die belegen, dass Menschen sich nur dann in kreative Prozesse begeben, wenn der Effekt für sie persönlich höher ist, als der Einsatz, den sie bringen. Das heißt, dass das Feedback anderer Personen darüber entscheidet, ob jemand sich kreativ betätigt.
Da eine kreative Aufgabe manchmal im Stillen stattfindet und sich nur innerhalb der Gedanken einer Person abspielt, ist es für Aussenstehende schwierig einzuschätzen, wann und wie unterstützt werden kann. Die kreative Person wird vor Beginn der Aufgabe abwägen, wie die Kritik wahrscheinlich ausfallen wird und dann entscheiden, ob sich der Aufwand lohnt. Das bedeutet, dass viele Menschen ihr kreatives Potential nicht einsetzen aus Angst vor Ablehnung und schlechter Bewertung.
Kreative Prozessmodelle
Um das Risiko für Menschen in kreativen Herausforderungen etwas zu senken, gibt es erprobte und bewährte Modelle, die als Leitplanken für die Aufgabe und Problemstellung dienen und so Sicherheit vermitteln.
Design Thinking ist sicherlich einer der bekanntesten Kreativprozesse, die regelmäßig angewendet werden. Diese Herangehensweise ist besonders hilfreich, wenn ein komplexes Problem vorliegt. Design Thinking ist ein systematischer, erforschender, iterativer, nutzer-basierter, agiler und lösungsorientierter Prozess mit offenem Ausgang. Um Design Thinking erfolgreich zu nutzen benötigt man ein team mit unterschiedlichen Perspektiven, spezielle Regeln als Grundlage der Zusammenarbeit und einen Raum, der Kreativität fördert. Der Prozess läuft nach festgelegten Phasen der Divergenz und Konvergenz ab und beginnt beim Verstehen des zukünftigen Nutzers der Lösung und endet beim Prototyp. Ich gebe gerne mehr Information zu möglichen Anwendungen und mehr Details zum Ablauf.
Eine andere Herangehensweise beschreibt das Creative Problem Solving (CPS), dass auch damit beginnt die Herausforderung zu verstehen. Danach werden Ideen entwickelt und als dritte Stufe bereitet man sich für die Umsetzung vor. In allen drei Phasen werden wie auch beim Design Thinking unterschiedliche Werkzeuge angewendet, je nach dem, was gerade hilfreich erscheint.
Zusätzlich zu kompletten Prozessmodellen können auch nur einzelne Werkzeuge angewendet werden, wie das bekannte Brainstorming oder eine Technik, die sich Scamper nennt.
Das Ziel des Einsatzes von Werkzeugen oder ganzen Abläufen ist es, das kreative Selbstbewusstsein zu erhöhen und damit den kreativen Akt und das Ergebnis zu verbessern.
Wenn Du jetzt neugierig geworden bist und mehr über einzelne Werkzeuge wissen möchtest, dann melde dich bei mir: hi@creativityboost.eu.