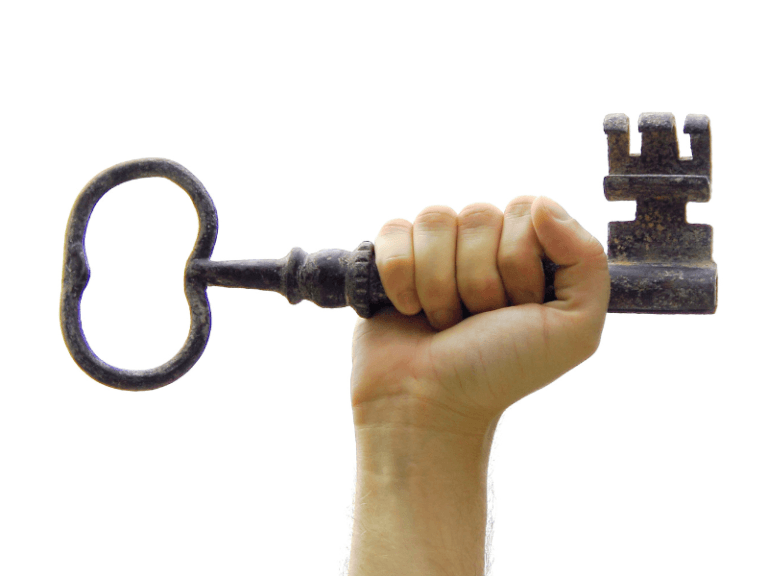Mehr Kreativität am Arbeitsplatz durch:
Kreativität ist eine der zentralen Fähigkeiten, die unser persönliches und berufliches Leben bereichern. Sie ermöglicht uns, neue Ideen zu entwickeln, Probleme zu lösen und Innovationen voranzutreiben. In meinem Studium und bei meinen Recherchen konnte ich viele Konzepte, Ansätze und Studien lesen und analysieren. Ein paar davon haben mich mehr inspiriert als andere. Die Autoren haben mit ihren Studien und Konzepten mein Verständnis von Kreativität nachhaltig geprägt. In diesem Beitrag möchte ich fünf Artikel, ihre Autoren, ihre wegweisenden Arbeiten und Perspektiven auf Kreativität näher vorstellen.
Ross C. Anderson – Kreative Entwicklung als lebenslanger Prozess
Ross C. Anderson beschreibt in seinem Artikel „Creative Development“ Kreativität als einen dynamischen Prozess, der sich über die gesamte Lebensspanne erstreckt.
Er hebt in seinem Artikel die zentrale Rolle kreativer Ressourcen (creative resources) für die persönliche und berufliche Entwicklung hervor. Er beschreibt kreative Ressourcen als eine Vielzahl von Fähigkeiten, Einstellungen und Verhaltensweisen, die Individuen dabei unterstützen, Aufgaben und Herausforderungen kreativ zu bewältigen. Dazu gehören unter anderem Offenheit, Vorstellungskraft, Toleranz für Ambiguität, intrinsische Motivation und Risikobereitschaft.
Anderson betont, dass diese Ressourcen nicht statisch sind, sondern durch gezielte Anstrengung und Übung weiterentwickelt werden können. Besonders interessant ist seine Unterscheidung zwischen domänenspezifischen und domänenübergreifenden Ressourcen. Während erstere für spezifische Bereiche wie Wissenschaft oder Kunst notwendig sind, können letztere in verschiedenen Kontexten angewendet werden und tragen zur allgemeinen kreativen Entwicklung bei. Beispielsweise kann die Fähigkeit zum divergenten Denken sowohl in der Musikkomposition als auch in der Problemlösung in der Technik von Nutzen sein.
Anderson argumentiert zudem, dass kreative Ressourcen durch soziale Interaktionen und kulturelle Einflüsse geprägt werden. Diese Perspektive verdeutlicht die Bedeutung eines unterstützenden Umfelds, das Menschen ermutigt, ihre kreativen Fähigkeiten zu erforschen und auszubauen. Durch diese multidimensionale Betrachtung zeigt Anderson auf, wie wichtig es ist, kreative Ressourcen nicht nur zu identifizieren, sondern sie aktiv zu fördern – sei es durch Bildung, berufliche Weiterbildung oder persönliche Reflexion.
Maciej Karwowski & Ronald A. Beghetto – Kreatives Verhalten als bewusste Entscheidung
In ihrem Modell „Creative Behavior as Agentic Action“ untersuchen Karwowski und Beghetto die Rolle von Selbstüberzeugungen und Werten bei der Umsetzung kreativer Potenziale in konkrete Handlungen. Sie argumentieren, dass kreatives Verhalten nicht nur vom Talent abhängt, sondern auch von der Überzeugung (creative self-efficacy) und dem Wert, den jemand der Kreativität beimisst.
Besonders spannend ist ihre Differenzierung zwischen verschiedenen Arten von Selbstüberzeugungen: Während die creative self-efficacy das Vertrauen in die eigene Fähigkeit beschreibt, kreativ zu handeln, bezieht sich das kreative Selbstkonzept auf eine langfristige Bewertung der eigenen kreativen Identität.
Ihre Forschung zeigt eindrucksvoll, dass Menschen mit einem starken Glauben an ihre kreativen Fähigkeiten eher bereit sind, Risiken einzugehen und innovative Ansätze auszuprobieren.
Teresa Amabile & Michael Pratt – Fortschritt als Motor für Kreativität
Teresa Amabile und Michael Pratt erweiterten 2016 das Dynamic Componential Model of Creativity and Innovation und lieferten damit eine tiefere Einsicht in die Dynamik kreativer Prozesse in Organisationen. Zwei zentrale Aspekte dieses Modells sind die Bedeutung von sinnstiftender Arbeit (meaningful work) und Rückkopplungsschleifen (feedback loops), die maßgeblich zur Förderung von Kreativität beitragen.
Fortschritt als Motivationstreiber
Das überarbeitete Modell betont, dass selbst kleine Fortschritte bei kreativen Aufgaben eine starke emotionale Wirkung haben können. Dieses sogenannte Progress Principle zeigt, dass das Gefühl, voranzukommen, positive Emotionen auslöst, die wiederum die intrinsische Motivation steigern. Diese Dynamik schafft eine Rückkopplungsschleife: Fortschritte fördern Motivation, die wiederum zu weiteren Fortschritten führt. Führungskräfte können diesen Effekt verstärken, indem sie Erfolge sichtbar machen und regelmäßig konstruktives Feedback geben.
Sinnstiftende Arbeit als Schlüssel zur Kreativität
Amabile und Pratt argumentieren, dass kreative Arbeit besonders dann erfolgreich ist, wenn Mitarbeitende ihre Aufgaben als bedeutungsvoll empfinden. Diese Sinnhaftigkeit entsteht beispielsweise durch das Bewusstsein, dass die eigene Arbeit einen positiven Einfluss auf das Team oder die Gesellschaft hat. Sinnstiftende Arbeit erhöht nicht nur das Engagement, sondern hilft auch dabei, Herausforderungen und Rückschläge besser zu bewältigen. Das Modell zeigt, wie wichtig es ist, Arbeitsumgebungen zu schaffen, in denen Mitarbeitende den Wert ihrer Beiträge erkennen können.
Rückkopplungsschleifen und emotionale Dynamik
Das Modell integriert Rückkopplungsschleifen zwischen Fortschritt, Emotionen und Motivation. Positive Emotionen fördern divergentes Denken und Problemlösungsfähigkeiten, während negatives Feedback – wenn es konstruktiv ist – kritische Reflexion anregen kann. Diese Schleifen verdeutlichen die Bedeutung eines unterstützenden Umfelds, das sowohl Erfolge würdigt als auch Raum für Verbesserungen bietet.
Yuri Scharp et al. – Spielerisches Arbeitsdesign als Innovationsmotor
Yuri Scharp und sein Team haben mit ihrem Konzept des Playful Work Design einen neuen Ansatz vorgestellt, wie Mitarbeitende spielerische Elemente in ihre Arbeit integrieren können, um Motivation und Freude zu steigern. Sie definieren spielerisches Arbeitsdesign als proaktive Strategie, bei der Mitarbeitende ihre Aufgaben so gestalten, dass sie entweder Spaß (designing fun) oder Herausforderung (designing competition) fördern.
Diese Ansätze gehen über traditionelle Arbeitsgestaltung hinaus und ermöglichen es den Mitarbeitenden, ihre kognitive Flexibilität zu stärken – ein entscheidender Faktor für kreatives Denken. Besonders spannend finde ich die Idee der Selbstinitiative: Anstatt auf externe Anreize zu warten, können Mitarbeitende selbst aktiv werden und ihr Arbeitsumfeld spielerisch gestalten.
Mehr zu Spielen und Arbeit gibt es hier.
Maciej Karwowski et al. – Das kreative Selbst
In ihrem Kapitel „Creative Self-Beliefs“ aus dem Cambridge Handbook of Creativity beleuchten Karwowski, Lebuda und Beghetto die Bedeutung des kreativen Selbstbildes (creative self-beliefs). Sie zeigen auf, dass Überzeugungen über die eigene Kreativität entscheidend dafür sind, ob Menschen ihr kreatives Potenzial entfalten können. Besonders bemerkenswert ist ihre Unterscheidung zwischen verschiedenen Dimensionen des kreativen Selbst:
- Die creative self-efficacy beschreibt das Vertrauen in die Fähigkeit zur kreativen Problemlösung.
- Das creative self-concept bezieht sich auf eine stabilere Bewertung der eigenen kreativen Identität.
- Die creative metacognition umfasst das Wissen über die eigenen Stärken und Schwächen sowie den Kontext, in dem Kreativität am besten eingesetzt werden kann.
Diese Überzeugungen beeinflussen nicht nur das kreative Handeln selbst, sondern auch die Bereitschaft, sich neuen Herausforderungen zu stellen.
Ein zentraler Aspekt der kreativen Selbstüberzeugungen (creative self-beliefs) ist das Konzept der creative mindsets, also der Überzeugungen darüber, ob Kreativität eine feste Eigenschaft oder eine veränderbare Fähigkeit ist. Menschen mit einem growth mindset sehen Kreativität als etwas, das durch Anstrengung, Übung und Lernen entwickelt werden kann, während ein fixed mindset davon ausgeht, dass kreative Fähigkeiten angeboren und unveränderlich sind.
Studien zeigen, dass ein growth mindset mit höherer kreativer Leistung, größerer Ausdauer bei Herausforderungen und einer positiveren Einstellung gegenüber kreativen Aufgaben verbunden ist. Besonders interessant ist die Erkenntnis, dass creative mindsets manipulierbar sind. Forschungen haben gezeigt, dass gezielte Interventionen – wie das Vermitteln von Wissen über die Plastizität des Gehirns oder das Hervorheben von Erfolgsbeispielen nach Anstrengung – dazu beitragen können, ein growth mindset zu fördern.
Diese Veränderung kann wiederum das kreative Selbstbewusstsein stärken und die Bereitschaft erhöhen, Risiken einzugehen und neue Ideen zu entwickeln. Solche Interventionen bieten vielversprechende Ansätze, um Kreativität in Bildungseinrichtungen und Organisationen aktiv zu fördern.
Fazit
Die Arbeiten dieser Wissenschaftler haben mein Verständnis von Kreativität nachhaltig geprägt. Ihre Perspektiven auf Kreativität haben meinen Beratungsansatz maßgeblich gestaltet. Sie zeigen auf unterschiedliche Weise auf, wie wichtig Selbstüberzeugungen, soziale Interaktionen und gezielte Förderung sind, um kreatives Potenzial in die Tat umzusetzen. Ob durch spielerische Ansätze am Arbeitsplatz oder durch das bewusste Entwickeln eines positiven Selbstbildes – diese Erkenntnisse inspirieren dazu, neue Wege zu gehen und das eigene kreative Potenzial voll auszuschöpfen.
Welche Autoren oder Konzepte haben Dich inspiriert? Ich freue mich auf den Austausch in den Kommentaren!