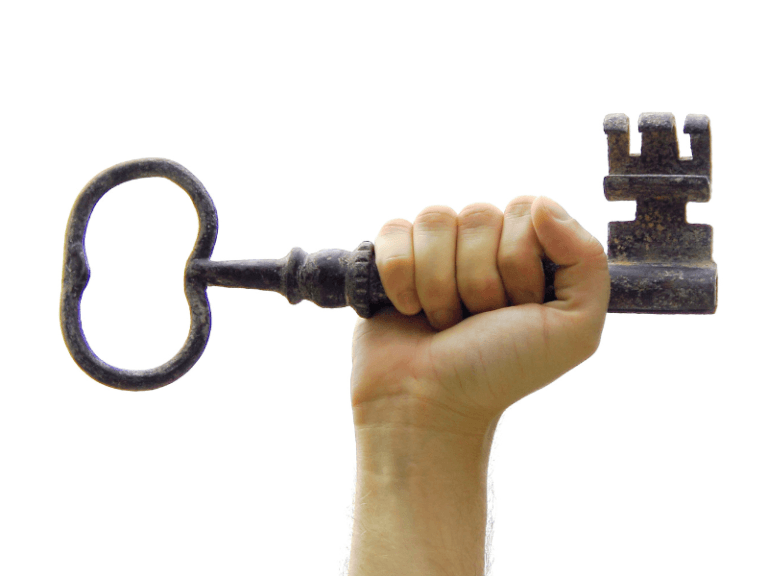Mehr Kreativität am Arbeitsplatz durch:
Ist es nicht eigentlich unmöglich bei allem vorhandenen Wissen und mit der gesamten vergangenen Geschichte neue Ideen zu haben? Sind das nicht immer auch Ideen, die andere schon hatten? Oder sind das nicht Ideen, die ein Computer schon längst durch Analyse und Kombination exemplarisch „bedacht“ hat? Geht es nicht eher um das Verhalten – die Umsetzung von Ideen? Für das Thema Kreativität ist das Element der „Neuartigkeit“ notwendiger Teil der Definition und ich möchte mich dem in diesem Artikel annehmen.
Definition von Kreativität
Das Gebiet der Kreativitätsforschung hat eine lange und reiche Geschichte, deren Wurzeln im frühen und mittleren zwanzigsten Jahrhundert liegen. Es wurden verschiedene Definitionen von Kreativität vorgelegt, und Forscher mit unterschiedlichem akademischem Hintergrund haben ihre einzigartigen Perspektiven und Erkenntnisse beigetragen.
Nach der gängigen Definition bezieht sich Kreativität auf Ideen, die neu und nützlich sind. Neuartigkeit wird auch als Originalität beschrieben, die für Kreativität wichtig ist, denn wenn eine Idee nicht einzigartig ist, ist sie nicht kreativ. Neuartigkeit ist jedoch nicht ausreichend für eine kreative Idee, da die chaotische Aneinanderreihung von Wörtern einer Person mit Psychose zwar ungewöhnlich sein mag, aber wahrscheinlich nicht als kreativ angesehen werden würde. Diese Überlegung impliziert, dass Originalität von der kontextbezogenen Beurteilung der Kriterien abhängt, die in Bezug auf ein Publikum oder im Fall des Begriffs „Neuheit“ in Bezug auf die Geschichte gemessen werden.
Das zweite Kriterium der Kreativität, die Nützlichkeit, wird als Effektivität, Angemessenheit, Relevanz, Passung und Wert bezeichnet. Um neue Ideen erfolgreich in Problemlösungsprozesse einzubringen, müssen sie nach einer Reihe von Standards bewertet werden. In organisatorischen Kontexten kann die Nützlichkeit als passend, richtig oder machbar beschrieben werden.
Im kreativen Akt gibt es Abhängigkeiten und dynamischen Wechselwirkungen und es ist möglich, dass der kreative Output nur für den kreativen Akteur neuartig und angemessen ist, um eine individuelle kreative Entwicklung zu ermöglichen. Eine neue Idee kann also nur für den Einzelnen neu sein, um ein Verhalten einzuleiten.
Ich bevorzuge daher eine umfassende Perspektive, die das gesamte Phänomen der Kreativität mit allen beobachtbaren Aspekten unter Berücksichtigung ihrer Wechselbeziehungen während des kreativen Akts anerkennt. Die dynamische Definition von Kreativität von Chetan Walia fasst das gut zusammen:
Kreativität ist ein Akt, der aus einer Wahrnehmung der Umwelt entsteht, die ein gewisses Ungleichgewicht anerkennt und zu einer produktiven Aktivität führt, die gemusterte Denkprozesse und Normen in Frage stellt und etwas Neues in Form eines physischen Objekts oder sogar eines mentalen oder emotionalen Konstrukts hervorbringt.
Diese Definition verortet einen kreativen Akt in einem dynamischen Umfeld, das soziale, emotionale und organisatorische Faktoren umfasst, die den kreativen Prozess behindern oder erleichtern können. Sie erkennt Kreativität als einen agierenden Prozess an, der Entscheidungsfindung und den Glauben an die eigenen Fähigkeiten beinhaltet. Darüber hinaus bezieht sich die Definition auf ein mentales oder emotionales Konstrukt als Ergebnis eines kreativen Akts, bei dem es sich um eine potenzielle Idee, Einsicht oder einen affektiven Zustand handeln könnte, der zur kreativen Selbstwirksamkeit und individuellen kreativen Entwicklung beiträgt.
Wie entstehen neue Ideen?
Kreativität ist ein Denkprozess, an dessen Ende Ideen stehen. Nach dem dynamischen Komponentenmodell für Kreativität und Innovation in Organisationen von Teresa Amabile und Michael Pratt braucht es dafür intrinsische Motivation, um die Aufgabe auszuführen, Expertise im entsprechenden Bereich und die Fähigkeit kreative Prozesse ausführen zu können. Gerade in kreativen Workshops wird dabei immer wieder hervorgehoben, dass auf wilde und verrückte Ideen gezielt werden soll. Dafür sollen alle Zwänge, Zweifel und damit die zugrundeliegende Erfahrung ausser acht gelassen werden. Hierbei wird ein großer Schwerpunkt auf die Methodik und die kreativen Werkzeuge gelegt.
Daraus entsteht ein Konflikt. Zum Einen ist es wichtig, dass man über Wissen verfügt, um kreative Ideen hervorzubringen. Zum anderen soll man mit dem Vergangenen brechen, um neue Ideen zu haben. Expertise würde in diesem Fall kreative Ideen behindern. Wie neu sind also neue Ideen wirklich?
Robert Weisberg ist für das Handbuch der organisatorischen Kreativität dieser Frage nachgegangen und hat Design Thinking Prozesse bei IDEO untersucht.
Da ich selber die Spielregeln und Werkzeuge von Design Thinking nutze und Teilnehmende in meinen Workshops ermutige „wilde Ideen“ zu haben, ist das Ergebnis für mich beeindruckend. Das Ergebnis der kreativen Prozesse basiert demnach nicht auf verrückten Ideen. Vielmehr entstammen die entwickelten Lösungen eher kleinen Bewegungen weg von dem Wissen, was die Teilnehmenden in Workshops haben und beisteuern. Also ist die Priorisierung auf Prozess und Methode nicht mehr so wichtig, wie die Expertise.
Kreativität ist Ideen-Recycling
Das Entwickeln von neuen Ideen folgt nicht einem speziellen kreativen Denken. Es ist das Ergebnis von kognitiven Prozessen und Verhalten, welche wir normalerweise nutzen. Ideen entstehen also durch gewöhnliches Denken und sind meistens keine radikalen Sprünge sondern funktionieren mit nahen Assoziationen. Kreativität nimmt alte Ideen und kombiniert diese zu neuen Ideen.
Das ist damit eine Erleichterung für Menschen, die glauben, dass sie nicht kreativ sind und keine neuen Ideen produzieren können. Durch das richtige Training und das Beibringen von einfachen Techniken und Methoden kann dieser Zweifel gemindert werden.
Das bedeutet im Unternehmenskontext, dass der Großteil der Mitarbeitenden zu mehr Kreativität motiviert werden kann. Dafür müssen die richtigen Rahmenbedingungen geschaffen werden.
Wenn Kreativität durch gewöhnliches Denken entsteht, sind dann kreative Trainings noch notwendig? ich glaube, dass die Antwort von der kreativen Herausforderung abhängt. Für alltägliche Probleme benötigen Mitarbeitende wahrscheinlich kein spezielles Kreativ-Training, sondern nur die von mir erwähnten organisatorischen Rahmenbedingungen. Lies hier weiter zu Führung und Arbeitsumfeld. Wenn die Probleme allerdings komplexer werden, dann kann ein solches Training sehr wohl positive Effekte erzielen, was durch diverse Studien bereits bestätigt wurde. Fähigkeiten des Teilnehmenden werden durch einen Workshop auch nicht verändert sondern nur verfeinert und geschärft.
Unabhängig davon, was wir jetzt unter Neuheit von Ideen verstehen und wie diese neuen Ideen entstehen, ist es wichtig, sich mit Ideenfindung auseinanderzusetzen. Gleichzeitig ist es wichtig, dass Mitarbeitenden die Möglichkeit im Unternehmen bekommen, neue Ideen zu generieren.